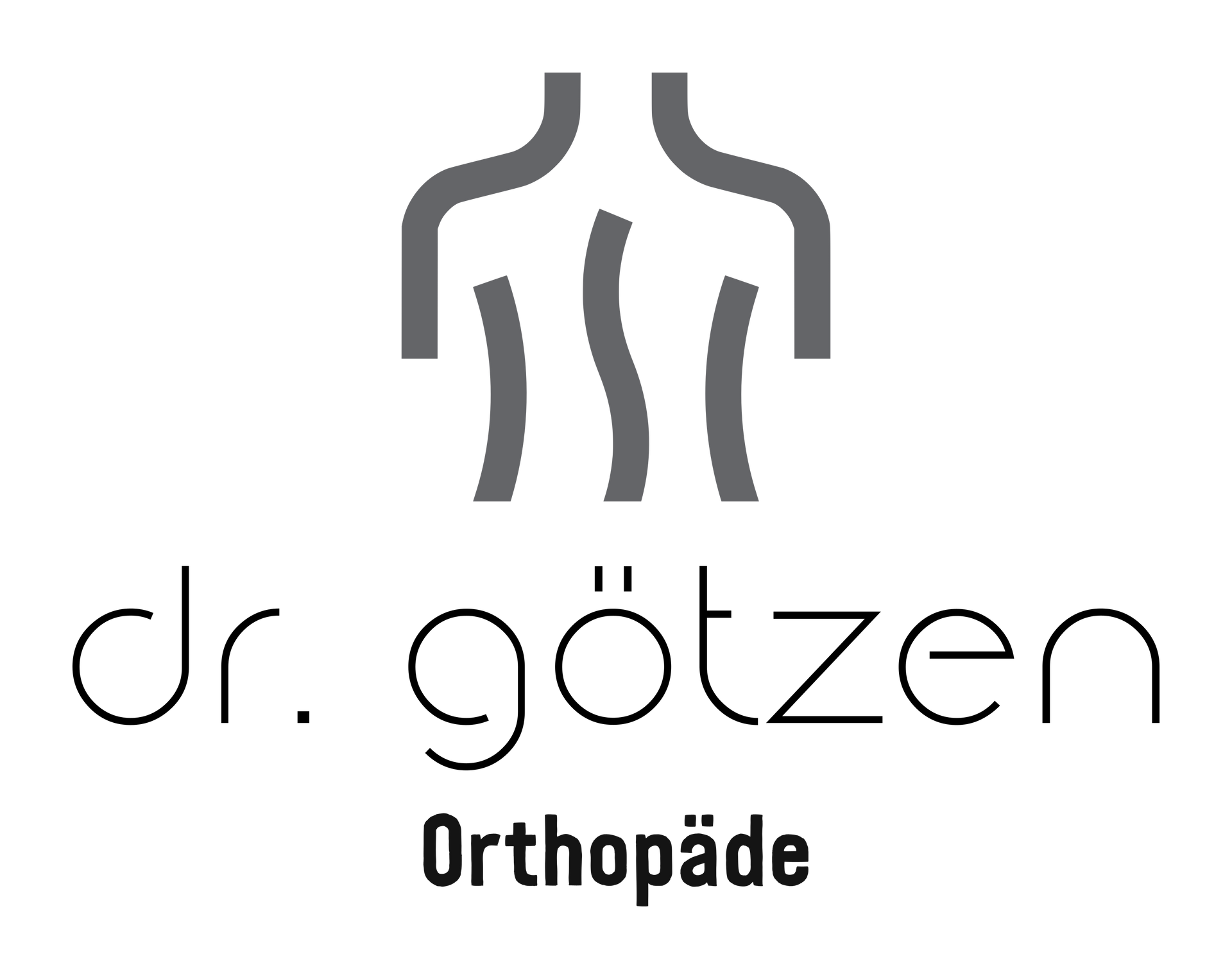WIRBELSÄULEN ERKRANKUNGEN
Detaillierte Beschreibung der Ursache, Therapie und Nachsorge
Rückenschmerzen
Kreuzschmerzen
Was sind Rückenschmerzen?
Der Begriff Rücken -oder Kreuzschmerz fasst viele Diagnosen und Ursachen zusammen. So wird beispielsweise der akute Kreuzschmerz häufig im Volksmund als Hexenschuss beschrieben. Die medizinische Diagnose dazu heißt akuter Lumbago. Dieser ist wieder definiert als einmaliges Ereignis mit Schmerzen im Lendenbereich, welche sich zu 90% innerhalb 6 Wochen selbstlimitieren.
Häufigkeit und Verbreitung des Rücken -und Kreuzschmerzes in der Bevölkerung
Der Kreuzschmerz ist die häufigste Volkskrankheit. Fast jeder Mensch leidet zumindest einmal in seinem Leben an einer Kreuzschmerzepisode:
• Lebenszeit-Risiko für Kreuzschmerzen bis 84%• Chronischer Kreuzschmerz 23%• Dadurch 11% stark beeinträchtigt/behindert
• 417 pro 10 000 Arztkonsultationen pro Jahr auf Grund von Kreuzschmerz• Im Kindesalter bereits 30 pro 10 000 Arztkonsultationen• Im Alter 45–64 sind es 536 pro 10 000 Arztkonsultationen• Ab dem 64 Lebensjahr leiden 50% aller Menschen an Kreuzschmerzepisoden
Diagnosen-Volksmund-Definitionen
Sowohl der Hexenschuss, der Low Back Pain, die ISG Blockade und der Lumbago verursachen Schmerzen im unteren Rückenbereich und werden dem Kreuzschmerz zugerechnet. Diese Schmerzen lassen sich nach einem zeitlichen Verlauf und der Ursache einteilen:
Zeitliche Einteilung• Akute Schmerzen dauern nicht länger als 6 Wochen• Chronische Schmerzen beginnen ab 3 Monaten und sind meist schwieriger zu behandeln. Es macht Sinn in diesen Fällen eine weitere Abklärung durchführen zu lassen.• Wiederkehrende akute Kreuzschmerzen (6 Monatiges schmerzfreies Intervall) sollten ebenfalls über einen Orthopäden abgeklärt werden
Kann der Schmerz einer eindeutigen Krankheit zugeordnet werden geht man von einem spezifischen Kreuzschmerz
aus. Ist dies nicht der Fall spricht man von unspezifischem Kreuzschmerz.
Ursache (Spezifischer Kreuzschmerz)Eine Schmerzquelle kann anhand objektiver Messparameter bestimmt werden. Kann beispielsweise anhand eines Röntgens ein Bruch diagnostiziert werden kann dieser gezielt behandelt werden. Als weiteres Beispiel ist ein spezifischer Krankheitsverlauf mit den dazugehörigen Laborparametern im Blut einem rheumabedingten Rückenschmerz zuzuordnen(Axiale Spondylarthritis). Am meisten Aufschluss bringt eine Magnetresonanzabklärung (MRT), bei der sowohl Knochen, Bandscheiben, Nerven und Weichteile der Wirbelsäule sichtbar sind. Kann der Schmerz mit einer im MRT sichtbaren Krankheit in Verbindung gebracht werden, kann diese spezifische Krankheit gezielt therapiert werden.
Ähnliche Erkrankungen (Differentialdiagnosen)
Viele weitere Erkrankungen der Wirbelsäule, der Bandscheiben, des Rückenmarks und der Rückenmarksnerven können den Kreuzschmerz begleiten. Dazu gehört der Bandscheibenvorfall oder die Rückenmarkskanalverengung. Im Volksmund meist als Ischias
beschrieben:
• Ausstrahlende Schmerzen vom Kreuz in Arme oder Beine
• Belastungsabhängige Ermüdung der Lenden -und Beinmuskulatur
Diese ausstrahlenden Schmerzen sind meistens Nervenschmerzen, welche verschiedenste Ursachen haben können. Kommt es zu einer Bedrängung der Rückenmarksnerven durch einen Bandscheibenvorfall treten meist bandförmige Schmerzen in einem Arm oder einem Bein auf. In manchen Fällen kann dies bis zur Lähmung führen. Ermüdende Beine unter Belastung, Krämpfe in der Nacht, sind häufig Einengung des Rückenmarkskanals. Viele weitere Nervenerkrankungen und Gefäßerkrankungen können ähnliche Symptome auslösen. Eine weitere Abklärung sollte durchgeführt werden.
Bandscheibenvorfall
Bandscheibenvorfall
Bandscheibenvorfälle äußern sich meist als bandförmig Schmerzen in Arm oder Bein (radikulärer Schmerz). Häufig bestehen auch Störungen des Hautgefühls und der Muskeln (Lähmungen).
Durch einen Bandscheibenvorfall (Diskusprolaps) oder einer Verengung beim Austritt einer Nervenwurzel (Foramenstenose, Recessusstenose), kann es zur Nervenreizung bis hin zur Lähmung kommen. Grund dafür ist zum Einen der mechanische Druck auf die Nervenwurzel, zum Anderen die Entzündungsreaktion, die durch das ausgetretene Bandscheibengewebe ausgelöst wird.
Bei Nervenschmerzen in Arm und Bein, die durch einen Bandscheibenvorfall ausgelöst werden, erzielt man gute Ergebnisse mit einer gezielten Wurzelblockade. Dabei werden röntgenuntersützt ein entzündungshemmendes Medikament (Kortison) und ein Betäubungsmittel an den Nerv gespritzt.
Wann sollten Bandscheibenvorfälle operiert werden?
Bei Lähmungserscheinungen sollte eine schnelle chirurgische Behandlung erfolgen, um bleibende Schäden zu vermeiden. Wichtig ist die Vermeidung von einem chronischem Schmerz. Bestehen die Schmerzen trotz konservativer Therapie und/oder Infiltration länger als 3 Monate hat sich in zahlreichen Studien gezeigt, dass sehr gute Ergebnisse mit der mikrochirurgischen Dekompression erreicht werden.
Operation
Die mikroskopisch assistierten Dekompression (Sequesterectomie), ist eine minimalinvasive Operation bei akuten Lähmungen oder wiederkehrenden Schmerzen. Dabei wird über einen ca. 3-5 cm langen Hautschnitt das störende Bandscheibengewebe geborgen und die Nervenwurzel befreit. Dies erfolgt mit dem Operationsmikroskop.
Bei bestimmten Bandscheibenvorfällen bietet sich auch die endoskopische transforaminale Dekompression an. Bei diesem Verfahren wird ähnlich wie bei einer Kniespiegelung, über eine kleine Kamera mit Führungshülse der Nerv aufgesucht und befreit.
Nachbehandlung
Es muss mit einem stationären Aufenthalt von ca. 1-3 Tagen gerechnet werden nach der Operation. Die Schmerzsymptome verbessern sich meist rasch nach der Operation. Lähmungserscheinungen erholen sich meist langsam und bedürfen einer intensiven Physiotherapie. Diese wird ambulant erfolgen. Unsere Therapeuten und Therapeutinnen sind gut vernetzt im Land und beraten Sie gerne. Mit einem Krankenstand von ca. 4-6 Wochen sollte gerechnet werden. Belastungen mit Hebetätigkeiten > 5 Kg sollten während dieser Zeit vermieden werden. Das Autofahren ist nach 6 Wochen wieder möglich, falls keine Lähmungen bestehen.